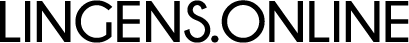Ein Versuch, Wien mit den Augen und Ohren eines Touristen zu erleben.
Die kommende Osterwoche dürfte Wien einen neuen Nächtigungsrekord für das Frühjahr bescheren, nachdem die Stadt schon im Vorjahr mit 14,3 Millionen Nächtigungen mehr Touristen als je zuvor beherbergt hat. Obwohl die Zahl der Besucher aus Russland um ein Drittel zurückgegangen ist, waren es 6 Prozent mehr als 2014. Noch eindrucksvoller ist der Blick zurück bis 2005: In den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl der Wien-Touristen um über 60 Prozent.
Eine entscheidende Ursache für diese auch wirtschaftlich fulminante Entwicklung ist zweifellos die Kulturpolitik der Bundeshauptstadt. Genau die Kulturpolitik, die ich anlässlich der vergangenen Wahlen an dieser Stelle kritisiert habe.
Zwar habe ich auch damals einschränkend festgehalten, dass Wien sein Kulturbudget auf Grund der Finanzkrise längst nicht im Ausmaß vieler deutscher Städte gedrosselt hat – aber doch stärker als dem Kulturleben gut tut.
Absoluter Höhepunkt meiner Wien-Tour war aber „Agrippina“-im Theater an der Wien.
Das war nicht völlig unrichtig. Ich halte es immer noch für falsch, dass durchaus leistungsfähige kleine Theater derzeit ohne jede Subvention auskommen müssen – aber ich muss zugeben, Partei gewesen zu sein: Ausgangspunkt meiner Kritik war das Wiener Ateliertheater, das eine Schauspielerin und ein Maler mit bloßen Händen in monatelanger Arbeit restauriert hatten und in dem sie, sich selbst ausbeutend, Produktionen zustande brachten, die sich mit denen etablierter, subventionierter Theater durchaus messen konnten.
Mit einer Jahressubvention von wenigstens 30.000 € hätte das kleine Theater (95 Plätze), das beim Publikum durchaus Anklang fand, (viele Vorstellungen waren ausverkauft) vielleicht überleben können, aber in drei Jahren seiner Existenz hat es niemals auch nur den Besuch eines Kulturverantwortlichen der Stadt erlebt, der versucht hätte, seine Subventionswürdigkeit zu eruieren.
Also hat es vor wenigen Wochen zugesperrt. (Auch wenn der neue Mieter des Lokals die Bühne für musikalische Auftritte weiter nützen will und damit hoffentlich Erfolg hat.)
Wirtschaftlich halte ich diesen Tod eines kleinen Theaters unverändert für verfehlt: Die öffentliche Hand muss jetzt einen Gutteil derer, die dort tätig waren, als Arbeitslose unterstützen – das kostet mehr als 30.000 Euro.
Kulturbetriebe – auch wenn sie im Gegensatz zu Spielstätten der USA durchwegs subventioniert sind- generieren durch den Kartenverkauf doch eine nicht unbeträchtliche Menge privaten Kapitals, aus dem zumindest ein Teil der Künstler-Gagen beglichen werden kann. Vor allem aber – und damit bin ich bei den eingangs angeführten Nächtigungsrekorden- ist ihre Umweg- Rentabilität gigantisch: Wiens Kulturbudget kommt über Wiens Tourismus-Einnahmen zig Mal zurück.
“Diese Geschichte von Ihnen“ von John Hopkins in der Regie von Andrea Breth sei ein absolutes „Muss“.
Das Angebot, das durch dieses Kulturbudget ermöglicht wird – an dieser Stelle muss ich mich korrigieren – ist nach wie vor atemberaubend.
Ich habe mich in den letzten Wochen in einen Touristen verwandelt und mit Hamburger Akzent bei einem Kartenbüro erfragt, was man mir derzeit als kulturelle Highlights anbieten könne, wobei ich besonderen Wert auf musikalische Events gelegt habe, weil die für Chinesen oder Amerikaner so attraktiv wie für Deutsche sind.
Der erste Hinweis betraf dennoch ein Sprechtheater – das Akademietheater, das die Stadt Wien als Bundestheater nur indirekt mitfinanziert: „Diese Geschichte von Ihnen“ von John Hopkins in der Regie von Andrea Breth sei ein absolutes „Muss“.
Das ist sie auch. Nicholas Ofczarek und August Diehl erzählen die Geschichte eines Mordes auf eine Weise, die einem den kalten Schweiß über den Rücken rinnen lässt und den Atem raubt – ich kann mir eine bessere Aufführung nirgends auf der Welt vorstellen.
Da ist auch der Abstand zu meinem Ateliertheater ein Abstand von mindestens einer Spielklasse. (Wenn auch nicht ganz der Abstand, den die Subventionen aufweisen.)
Einen Klavierabend mit Jewgeni Kissin, den ich mir als erstes musikalisches Event gegönnt habe, kann man zwar auch in anderen Konzerthallen und gelegentlich sogar mit einem eindrucksvolleren Programm, nicht aber in einem Raum von der Schönheit des großen Musikvereinssaals genießen. Japaner, die mir ein Viertel des Publikums auszumachen schienen, nahmen jedenfalls einen unvergleichlichen Eindruck mit.
Ebenso wie von Rossinis Othello im Theater an der Wien: Eine unglaubliche Menge grandioser Männerstimmen, eine sehr schöne Desdemona und eine Inszenierung, die die venezianische Tragödie ohne jeden Krampf in die Gegenwart transponiert, wie das zu einem Markenzeichen dieser Bühne geworden ist. So wagt Regisseur Damiano Michieletto sogar den Schluss des Dramas zu modifizieren: Desdemona wird nicht von Othello erwürgt sondern erschießt sich mit seiner Pistole, nachdem sie erlebt hat, wie ihr Vater und ihre gesamte Umgebung auf Grund ihrer Heirat von ihr abgerückt ist. Das stimmt nicht mit Shakespeares Vorlage überein – aber es ist in sich absolut stimmig.
Wieder applaudiert ein gut zur Hälfte aus Touristen bestehendes Publikum frenetisch.
Eher beim heimischen Publikum dürfte dagegen „Evita“ im Ronacher punkten, obwohl auch dort eine Weltklasse- Inszenierung geboten wird: Vincent Paterson hat auch bei der Verfilmung mit Madonna Regie geführt. Bühnenbild und Besetzung sind jedenfalls Europa-Klasse und musikalisch ist Evita zweifellos Andrew Lloyd Webbers bestes Musical. Bei der Premiere übersteuern die Lautsprecher im ersten Akt, aber nach der Pause ist auch diese Aufführung perfekt und wird bejubelt.
Absoluter Höhepunkt meiner Wien-Tour war aber „Agrippina“- abermals im Theater an der Wien. Die zweite Oper des 24jährigen Georg Friedrich Händel hat – was bei Opern nicht unbedingt die Regel ist – ein kongeniales Libretto, das dem kaiserlichen Botschafter im Venedig des 17. Jahrhunderts, Kardinal Vincenzo Grimani, zugeschrieben wird. Mit entsprechender Sachkenntnis erzählt der Diplomat von den Intrigen, mit denen Agrippina, die blonde Tochter des Germanicus und zweite Frau Kaiser Claudius, ihren Sohn aus erster Ehe Nerone (Nero) im ersten Jahrhundert nach Christus zum (blutigen) Thronfolger gemacht hat.
Grimani nutzt diesen Stoff, der schon Seneca zu einer (parteiischen) Ode veranlasste, mit beispiellosem Witz und Sarkasmus für eine römische Sittengeschichte. Claudius ist für ihn ein ebenso dummer, wie selbstgefälliger Kaiser, dessen Interesse sich weitestgehend auf Frauen beschränkt: Neben seiner Ehefrau hat er stets diverse Geliebte, deren letzte, Agrippina, er an seiner Seite zur Kaiserin erhoben hat. Für ein solches Amt ist sie ungleich geeigneter als er – nur dass sie es lediglich in seiner Abwesenheit tatsächlich ausüben kann.
Zu Beginn der Oper ist sie daher bester Hoffnung, dass er bei der Heimkehr von einer Seeschlacht ertrunken ist.
Ihr Verhältnis zu Männern unterscheidet sich von dem seinen zu Frauen insofern, als ihr ihre Geliebten nicht nur zur Lust, sondern vor allem zur Erweiterung ihrer Macht dienen müssen: Zweien von ihnen, Claudios rechter Hand Narciso und seinem Schatzmeister Pallante verspricht sie, während sie mit ihnen schläft, die Ehe, wenn sie ihr helfen, ihren Sohn Nerone zum Nachfolger ihres tot geglaubten Mannes zu machen – damit sie durch Nerone regieren kann. Denn der ist zum Regieren so ungeeignet wie Claudius. Wie dieser hat er nichts als Frauen, voran die schöne Poppea, im Kopf und ist nur zu froh, dass seine Mutter ihm jegliche Arbeit und Verantwortung abnimmt.
Doch zu ihrem und seinem Pech taucht Claudius, von dem mutigen Offizier Ottone aus dem Wasser gefischt, wieder im Palast auf und will seinen Retter zum Dank zum Thronfolger machen. Agrippina muss also neuerliche Intrigen zu Gunsten ihres Sohnes schmieden und will dazu Poppea benutzen, von der sie weiß, dass nicht nur Nerone, sondern auch ihr Ehemann dingend öfter mit ihr schlafen wollen, während sie insgeheim nur Ottone liebt. Das, so hofft sie nicht ganz zu unrecht, würde Ottone nicht überleben.
Doch Poppea durchschaut Agrippinas teuflischen Plan, spielt Claudius und Nerone gegen einander aus und trägt so zum auch 1709 unvermeidlichen Happy End bei: Ottone verzichtet Poppea zuliebe auf den Thron, Claudius, der Frauen dem Thron ohnehin vorzieht, macht Nerone zu seinem Nachfolger, nachdem es Agrippina gelungen ist, ihm ihre Intrigen als Schutz seiner Stellung zu verkaufen.
Auf Agrippinas Rat hin verteilt Nero, begleitet von einem Fernsehteam, wie weiland Jörg Haider, Geldscheine.
Diese Handlung ist schon in Grimanis Fassung so frivol, so voller Ironie, so Zeit- und Regimekritisch, dass man staunt, dass diese Oper – freilich in Grimanis eigenem Theater –1709 ohne Eingreifen irgend eines Zensors uraufgeführt werden und Triumphe feiern konnte.
In der genialen Inszenierung von Robert Carsen ist im Theater an der Wien aus dieser Sittengeschichte des alten Roms aber eine hoch aktuelle Sittengeschichte Italiens im letzten Jahrhundert geworden: Agrippina, als stellvertretende Vorstandsvorsitzende eines Imperiums, das zu Beginn Silvio Berlusconis Medien-Imperium, danach Benito Mussolinis faschistischem Imperium und zuletzt doch wieder dem zerfallenden Imperium Roms zum Verwechseln ähnlich ist. Agrippina zwischen Carla Bruni und Hillary Clinton: Eine „starke Frau“, die herrschen könnte und herrschen wollte, wenn sie die Chance dazu hätte und nicht ungleich dümmere, schwächere Männer vom Schlage Donald Trumps ihr den Weg verstellten.
Grandios verkörpert wird die Titelheldin durch Patricia Bardon: erotisch wie Evita, durchtrieben wie Evita, und beinhart. Wenn sie auf ihrem riesigen Schreibtisch nacheinander zwei enge Mitarbeiter ihres Mannes verführt, grenzt das an einen sehr guten Pornofilm; wenn sie ihren Sohn aufklärt, wie man das Volk durch scheinbare Mildtätigkeit verführt, ist es aktueller Polit-Porno: Genau so hat Jörg Haider die Kärntner eingekauft. Bardon schauspielerische Leistung braucht den Vergleich mit Meryl Streep in „Der Teufel trägt Prada“ nicht zu scheuen – zusätzlich hat sie einen herrlichen Mezzosopran.
Ebenso großartig stimmlich wie darstellerisch Mika Kares als Claudio (Mussolini, Berlusconi) und Jake Arditti als Muttersöhnchen Nerone.
Um Carsens grandiose Regie-Arbeit an einem von Dutzenden Details zu illustrieren: Auf Agrippinas Rat hin verteilt Nerone, begleitet von einem Fernsehteam, wie weiland Jörg Haider, Geldscheine an „Arme“, scheinbar Flüchtlinge, die in Fetzten gekleidet am Boden hocken. Als das Fernsehteam seine Arbeit getan hat, streifen sie die Fetzen ab: es sind Mitarbeiter Agrippinas.
Alles an dieser Inszenierung ist absolute Weltklasse. Die Ausstattung durch Gideon Davey zum Beispiel: Als durchgehendes Bühnenbild dient eine bis zum abstrakten Gemälde vereinfachte Nachbildung des faschistischen „Palastes der italienischen Zivilisation” der seinerseits dem Kolosseum nachempfunden ist, aber ebenso gut eine Villa Berlusconis sein könnte. Dass Nerones (Neros) Ernennung dort in eine wilde Sex-Orgie mündet, ist in keiner Sekunde billige Spekulation mit dem Voyeurismus des Publikums, sondern von zwingender innerer Logik: So und nicht anders musste dieses Imperium und muss diese Oper enden.
Nur das Außergewöhnliche dieser Inszenierung lässt die Würdigung der musikalischen Qualität der Aufführung vergleichsweise kurz ausfallen: Es dürfte wenigen Opernhäusern gelingen, zwei grandiose Countertenöre (Jake Arditti, Filippo Mineccia) und einen sehr guten Countertenor (Tom Verney) auf der selben Bühne zu vereinen; Daniela de Niese ist eine bezaubernde Poppea, die mit Ottone das schönste Duett des Abends singt; schwach ist in diesem Ensemble niemand – selbst die Statisten, Bodybuilder und „Models“, sind stark.
Dazu kommt mit dem Balthasar Neumann Ensemble ein Klangkörper von der Qualität des „Concentus Musicus“ Nicolaus Harnoncourts, aus dem Thomas Hengelbrock die feinsten musikalischen Nuancen herausholt: Die Freude, mit der er dirigiert, spiegelt sich im Gesicht jedes einzelnen seiner Musiker wieder.
Eine Aufführung dieser Qualität müsste jeden Besucher, Wiener oder Touristen, der Augen und Ohren hat, zu Beifallsstürmen hinreißen – und so war es auch.
Bessere Werbung für Wien ist nicht möglich.