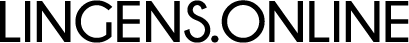Nach den grauenvollen Nestroy-Inszenierungen der Ära Hartmann begeistert sich Ronald Pohl im “Standard”, (wie “Die Presse”, der “Kurier” und die “Kleine Zeitung”) für Georg Schmiedleitners Inszenierung von Nestroys “Liebesgeschichten und Heiratssachen” am Burgtheater. Renate Wagner widmet ihr im “Merker” einen Totalverriss. Mir scheint die Wahrheit irgendwo dazwischen, aber näher bei Wagner zu liegen.
Ich identifiziere mich am ehesten mit Michaela Mottingers Meinung: Das Publikum kommt auf seine Rechnung – wenn auch manchmal sehr billig: am meisten wird gelacht, wenn ein mechanisches Plüsch-Schwein über die Bühne saust.
Überhaupt führte die Bühnentechnik der Burg, wie neuerdings fast immer, vor, was sie alles kann: Ein Sofa dreht sich wie von Geisterhand; der Bühnenraum dreht sich wie eine Skulptur, die für den Eurovisions-Contest erdachte wurde, damit auch Hintergrund-Akrobatik stattfinden kann.
Viel Aufwand für Gott sei Dank nicht sehr lange Sequenzen, die man kostengünstig beruhigt weglassen könnte, ohne dass Nestroy oder mir etwas abginge. (Stattdessen, so fürchte ich, soll der so sichtbare Einsatz der Bühnentechnik wohl ihre unabwendbaren Grundkosten rechtfertigen.)
Nicht zuletzt wurde auch die sich drehende Bank vom Publikum mit soviel Gelächter bedankt, dass ich der Regie ihren minutenlangen Einsatz nicht vorwerfen kann: Man kann in ihr ein neureiches Spielzeug sehen, das alle abwirft, die von anderer Herkunft sind. So wie sie im Publikum wohl nur sie abwirft.
Auch das Bühnenbild ist, wie neuerdings an der Burg fast immer, auf keinen Fall “traditionell”, sondern soll mit viel Plastik, Metallgestängen und Leuchtstoffröhren darauf hinweisen, wie zeitnah Nestroys Stück doch ist.
Ich glaube dass es das nicht nötig hat. Man hätte es beruhigt wie vor Jahrzehnten auch vor einer gemalten Biedermeier-Kulisse seiner Entstehungszeit spielen lassen können, ohne dass es an Zeitlosigkeit eingebüßt hätte. Die Augen hätten vermutlich mehr Vergnügen daran gehabt, wenn auch weniger Spektakel mit angesehen.
Die andere opulente Möglichkeit hätte darin bestanden, realistischen, aktuellen, neureichen Protz auf der Bühne durch satirische Übertreibung bloß zu stellen, indem das Bühnenbild in die Kitzbühler Villa eines russischen Oligarchen oder in Donald Trumps “Resort” in Florida versetzt. Das wäre meines Erachtens amüsanter, adäquater und eindringlicher als Plastikvorhänge, eine Leih-Toilette und eine in den Raum gehängte Wohn-Kabine gewesen.
Diese Unfähigkeit, die Zeitlosigkeit von Nestroy Texten spürbar zu machen, indem das Publikum ihnen einfach nur zuhören kann, ohne dabei von mechanischen Leistungen der Bühnentechnik oder akrobatischen Leistungen der Schauspieler abgelenkt zu werden, charakterisiert in meinen Augen die ganze Inszenierung des hochbegabten Linzer Regisseurs. Er inszeniert flüssig, ohne Lehrläufe, im Wissen um die Brillanz seiner Schauspieler und um die Notwendigkeit, ihnen effektvolle Auftritte zu bescheren – er wurde durchaus zu Recht nach Wien eingeladen. Aber sein vielleicht durch diese ehrende Aufgabe besonders intensives Bemühen, ja nicht “traditionell” zu inszenieren ist dabei, eine zunehmend langweilige Tradition des Burgtheaters zu werden.
So will Schmiedleitner offenbar auch zeigen, dass Nestroy nicht nur “wienerisch” gespielt werden kann. Ein durchaus verständliches Anliegen, das an Österreichs Bühnen auch bei Schnitzler-Inszenierungen immer wieder unternommen wird und das etwa Andrea Breth mit ihrer Salzburger Inszenierung von “Das weite Land” grandios gelungen ist. Bei diesem Bemühen spielt die Sprache zwangsläufig eine wesentliche Rolle. So hat etwa Franz Schuh in einer Kritik typischer einstiger Schnitzler – Inszenierungen an der Josefstadt schon vor Jahrzehnten angemerkt, dass sie deshalb nicht mehr wirklich funktionieren, weil es die Schauspieler nicht mehr gibt, die noch Schnitzler-Deutsch sprechen – sondern nur mehr solche, die es nasal imitieren.
Damit mag er für Schnitzler Recht haben – aber Schauspieler, die Nestroy-Deutsch sprechen gibt es in Österreich noch genug.
Sie waren nur in dieser Inszenierung nicht zu hören.
Mit Johannes Kriesch in der Rolle des “Nebel” und Nicholas Ofczarek in der Rolle des reich gewordenen Feischers “von Fett” wäre die gleiche Inszenierung vermutlich um eine Klasse besser ausgefallen.
Dabei sind der Niedersache Markus Meyer und der Tiroler Gregor Bloéb nicht minder brillante Schauspieler. Aber ich fürchte für eine Reihe noch so hervorragender deutscher oder Tiroler Darsteller, dass Nestroy-Deutsch im Gegensatz zu Schnitzler- Deutsch nie ganz vom Wienerischen zu trennen ist. Die Wiener Wortmelodie, der Nestroys Texte durchwegs folgen, ist eine besondere und wenn sie nicht eingehalten wird, verlieren die Textbausteine ihren delikaten inneren Zusammenhalt und damit an Gelenkigkeit und Stoßkraft.
Nestroy hat gerade in Liebesgeschichten und Heiratssachen seine wohl brillantesten Wortspiel-Kaskaden aufgetürmt -keiner der Darsteller dieser Inszenierung hat sie zu zelebrieren gewusst.
Obwohl mir etwa Markus Meyers Darstellung des “Osvald Alving” in Ibsens “Gespenster” bis heute als unvergleichlich in Erinnerung ist, bleibt er als “Nebel” blass.
Die mangelnde Identifikation mit Nestroys Sprache scheint auf die Identifikation mit dieser Figur insgesamt abgefärbt zu habe: Meyer nimmt, im Gegensatz zu seinem sonstigen Herangehen, nicht alle Schichten dieser Rolle wahr.
Nestroys “Nebel” ist undurchsichtig und dennoch konturiert. Ein abstoßend skrupelloser Heiratsschwindler und ein dennoch hinreißend anziehender Verführer. Ein Emporkömmling und ein dennoch ein zu Unrecht Erniedrigter. Ein perfider Zechpreller und dennoch einer, der in seinem rechtswidrigen Streben nach Geld die Ungerechtigkeit in der Verteilung des Reichtums fast wie ein edler Revolutionär entlarvt. Einer Verteilung, die ihn trotz seiner Begabung, Intelligenz und Eloquenz einen armen Schlucker sein lässt, während andere ganz einfach den Reichtum ihrer Väter genießen.
Aktueller geht es nicht – aber zu wenig davon wird in Meyers Darstellung spür- und hörbar, weil er ständig mit der Sprache kämpft. Schon sein Eingang-Couplet, das er nicht singt, sondern spricht, ist nur ganz schlecht zu verstehen und auch später findet er nicht zu Nestroys Sprachmelodie, so dass man ihm nicht wie sonst mit gespannter Aufmerksamkeit durch die Handlung folgt.
Er, der die Nebenrolle des “Osvald Alving” zu einer Hauptrolle machen konnte, macht die Hauptrolle des “Nebel” beinahe zu einer Nebenrolle.
Auch Georg Bloéb, den ich zuletzt als grandiosen “Johann Rukeli Trollmann” in Mitterers “Der Boxer” bewundern durfte, enttäuscht mich als “von Fett”, obwohl er die Bühne wie kein anderer beherrscht. Aber er ist kein verlegener Neureicher, den seine Allüren zur komischen Figur machen sondern er mimt ihn, indem er denkbar gekonnt outriert. Seine Slapstick-Stolzier- Einlagen sind im höchsten Ausmaß professionell und reißen das Publikum zu Lachstürmen hin – aber mit der Figur, die Nestroy zeichnen wollte, haben sie nichts zu tun. Dieser “von Fett” ist nicht in tiefster Seele unsicher, sondern sicherer als sein Gegenspieler von altem Adel. Und das mag zwar manchmal vorkommen, aber so hat es Nestroy nicht konzipiert.
Bloéb siegt in dieser Rolle durch technischen KO der Figur, die er eigentlich sein soll.
Damit sind die beiden Hauptrollen in meinen Augen falsch besetzt und bzw. falsch inszeniert und das verdeckt für mich, dass die Inszenierung durchaus auch ihre Stärken hat und alle Schauspieler ihre Sache professionell erledigen.
Mein Urteil deckt sich allerdings in keiner Weise mit dem des Publikums: Das hat so laut geklatscht wie es gelacht hat.
Damit muss man wohl von einem Bühnenerfolg sprechen.
Als Service-Tipp: Das Stück ist so unglaublich gut, dass der Besuch auf jeden Fall lohnt.
Petra Lynn