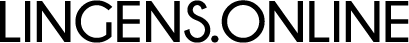Wladimir Putin schafft 2024 das größte Blutbad seit Adolf Hitler. Der Welt droht das Comeback Donald Trumps und Österreich ein Kanzler Herbert Kickl
Es fällt schwer, dem neuen Jahr optimistisch entgegenzusehen. Bisher verantwortete Iraks Saddam Hussein bei seinem Überfall auf den Iran mit geschätzten fünfhunderttausend Kriegstoten das größte Blutbad seit Adolf Hitler – 2024 wird ihn Wladimir Putin in der Ukraine um Leichenberge übertreffen. Und sollte Donald Trump tatsächlich wieder zum Präsidenten der USA gewählt werden, so hören nicht nur sie auf, ein demokratischer Rechtsstaat zu sein, sondern alle halbwegs demokratischen Staaten verlieren die weltstärkste Armee als sicheren oder zumindest denkbaren Schutz vor den Diktaturen Russlands, China und des Iran.
Für die Ukraine bedeutete ein Wahlsieg Donald Trumps die fast sichere Niederlage: Reduziert auf die Unterstützung der EU, die Viktor Orban jederzeit torpedieren kann, hielte sie Russlands Übermacht kaum weiter stand. Nur, dass Putin riesige Truppen brauchte, um das riesige Land unter Kontrolle zu halten, hindert ihn vielleicht, sofort Georgien zu kassieren und in Moldawien vorzustoßen. Ein Nato-Land griffe er meines Erachtens nicht an, weil ich nicht glaube, dass Trump die Nato tatsächlich auflöste, wenn sie die USA nichts kostet. Am ehesten lockerte er freilich die Beistandspflicht, was gefährlich genug wäre. Entgegen stünde dem, dass sichere Verbündete in der Konfrontation mit China auch für Trump von Vorteil sind – aber denkt er so weit?
Anders als die Ukraine profitierte Israel von Trumps Sieg: Der unterstütze, was immer es im Westjordanland und in Gaza täte. Ein Rechtsstaat blieb es dann kaum und auch einen Flächenbrand in Nahost schlösse ich nicht völlig aus.
Ich glaube, dass es nötig ist, so weit in die Zukunft zu spekulieren, weil Umfragen Trump derzeit in 5 von 6 der bisher stets wahlentscheidenden Swing-States vor Joe Biden sehen, auch wenn ich hoffe, dass die gute Wirtschaftslage und der insgeheime Widerstand der Frauen gegen die Abtreibungsgesetze der Republikaner diese Umfragen Lügen strafen.
Was wird aus Kickl?
In Österreich wird die Umfrage-Führung der FPÖ so gut wie sicher in ihren Wahlsieg münden, zumal die Rezession, die uns die Geldpolitik der EZB bescherte, Herbert Kickl weiter Stoff für wüste Kritik liefern wird, obwohl diese Regierung dafür keinerlei Verantwortung trägt.
Allerdings bleibe ich zuversichtlich, dass Kickl keinen Partner findet, um tatsächlich zu regieren, selbst wenn die ÖVP sich von Karl Nehammer trennt. Zum einen, weil ihr christlich-sozialer Flügel nicht völlig abgedankt hat, zum anderen, weil ihr auch ein Kanzler Andreas Babler das Finanzministerium überließe und weil mir ihre Chance, Babler dereinst durch einen schwarzen Kanzler abzulösen, größer scheint als die Chance auf die Ablöse Kickls, wenn der sich etabliert hat.
Ich rechne daher relativ fest mit einer Koalition aus SPÖ, ÖVP und NEOS oder Grünen, denn eine rote Minderheitsregierung zu dulden hat die ÖVP keinen Anlass und Kickl dürfte Babler kaum die Chance einräumen, die Friedrich Peter Bruno Kreisky eingeräumt hat. Denn Kickls größte Chance besteht darin, fünf Jahre zuzuwarten, um dann allein zu regieren – das wünschen auch seine Wähler.
Deshalb muss die wahrscheinliche Dreierkoalition unbedingt begreifen, dass sie sich augenscheinlich bewähren muss, wenn sie Kickl = Österreichs Orbanisierung nachhaltig verhindern will. Dazu ist unverzichtbar, dass die beteiligten Parteichefs ein brauchbares Verhältnis zueinander haben. Babler hat mittlerweile begriffen, dass er politische Profis zu seiner Unterstützung braucht – vielleicht begreift er auch, wie kontraproduktiv es ist, wenn er Karl Nehammer im Einklang mit Kickl beschimpft: Er treibt damit nur Wähler zur FPÖ.
Bei der Frage, welche wesentliche wirtschaftliche Verbesserung die künftige Koalition bewirken könnte, drängt sich auf, endlich, wie von OECD, IWF oder WIFO-Steuerexpertin Margit Schratzenstaller und allen einigermaßen kundigen Ökonomen seit langem gefordert, die Steuern auf Arbeit in dem Ausmaß zu senken, in dem man die Steuern auf Vermögen auf ein Mittelmaß anhebt. Für Babler ist die Forderung nach höheren Vermögenssteuern bekanntlich Wahlprogramm und eine Erbschaftssteuer mit hohen Freigrenzen erfüllte es am einfachsten. Nur darf er keine Zweifel lassen, dass er die Steuern auf Arbeit im gleichen Ausmaß senkt, denn dann hat er nicht nur Grünen-Chef Werner Kogler, sondern auch Neos-Chefin Beate Meinl Reisinger auf seiner Seite und macht es der ÖVP um Vieles schwerer, bei ihrem sturen „Nein“ zu bleiben.
Die ÖVP ist leider Gefangene ihrer speziellen Klientel von Superreichen und Großspendern, die natürlich vorzieht in einem Land zu leben, das nach Mexiko und der Slowakei die niedrigsten Vermögenssteuern der Welt hat – aber die Gruppe derer, die von niedrigeren Steuern auf Arbeit profitierten, ist natürlich auch unter VP- Wählern die viel größere – sie hat nur anders als die Superreichen keine Lobby. Deshalb muss es Babler, Meinl Reisinger und Kogler gelingen, der ÖVP klarzumachen, dass sie in dieser Frage die Mehrheit der Bevölkerung gegen sich hat und dass das in der jüngsten Umfrage schon offenbar so war. Bei Finanzminister Magnus Brunner sollten auch Gespräche mit Margit Schratzenstaller helfen und selbst bei Karl Nehammer gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass er erkennt, dass hohe Steuern auf Arbeit die Wirtschaft mehr belasten als durchschnittliche Steuern auf Vermögen