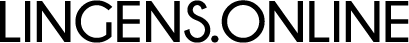Österreich verzeichnet die höchste Beschäftigung aller Zeiten. Zugleich Reallohnverluste und die aktuell höchste Armutsgefährdung. Die Arbeitslosigkeit ist ausgelagert.
Man soll alles immer von zwei Seiten betrachten. Als ich mir Herbert Kickls Bierzelt- Rede auf YouTube angehört habe, dachte ich zuerst: Hoffentlich hören das möglichst viele Leute, denn nirgends kann man klarer sehen, wohin er Österreich führt. Aber gleich darauf hat sich diese Hoffnung in die Furcht verkehrt, dass die Mehrheit der Österreicher so beschaffen sein könnte, dass Kickls Rede sie begeistert.
Die SPÖ hat jedenfalls nur anderthalb Jahre Zeit, um stark genug zu werden, uns in einer Koalition mit Grünen und NEOS davor zu bewahren, einer faschistoiden Zukunft entgegenzusehen. Ursprünglich hatte ich nach der Rede Karl Nehammers im KZ Mauthausen gedacht, dass auch die ÖVP keine Koalition mit Kickls FPÖ einginge, aber Niederösterreich und Salzburg haben mich gelehrt: Österreich könnte 2024 tatsächlich neben Ungarn, aber vor Polen und Italien, zum EU-Land mit der rechtsextremsten aller Regierung werden – der einzigen, die die “Panzerkolonnen der NATO” mit Kickl heftiger ablehnt als Wladimir Putins Aggression.
Gemessen daran wirken alle anderen Sorgen, die diese erste Mai-Woche aufwirft, unerheblich: Statt zu fallen stieg die Inflation angeblich wegen verteuerter Nahrungsmittel – genau weiß es niemand- um 0,6 Punkte auf 9,8 Prozent. Voran der Abstand von 2,6 Prozent zu Deutschland macht dabei Sorgen, könnte er doch den Wettbewerb erschweren. Nachträglich lässt sich jedenfalls sagen: Die Strompreisbremse wurde zwar rechtzeitig erdacht, aber zu spät verwirklicht, auf eine gleichartige Gaspreisbremse und eine Mietpreisbremse wurde ebenso verzichtet wie auf Preiskontrollen. Zugleich hat das Fehlen von Vermögensdaten allen Hilfsmaßnahmen die Treffsicherheit genommen, so dass der finanzielle Aufwand in keinem Verhältnis zum Erfolg steht. Dennoch wird die Inflation langsam abklingen, denn der Ölpreis ist nun einmal gegenüber seinem Höchststand deutlich gefallen.
Auch Österreichs Arbeitslosigkeit ist minimal gestiegen. Wahrscheinlich vor allem, weil die Statistik jetzt auch geflohene Ukrainerinnen umfasst – aber vielleicht auch, weil Österreich sich schon in einer Rezession befindet: Das Wirtschaftswachstum ist den zweiten Monat, wenn auch minimal, rückläufig. Die Zinserhöhungen der EZB haben voran die Bauwirtschaft eingebremst und meines Erachtens werden sie die gesamte Wirtschaft schneller als die Inflation bremsen – aber ich hoffe, dass ich mich irre.
Doch zwischen solchen negativen Nachrichten vermochte Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher eine höchst positive zu verkünden: Mit 77,5 Prozent sind derzeit mehr Österreicher denn je erwerbstätig. Zu verdanken ist das der gestiegenen Erwerbstätigkeit von Frauen, die 71,6 Prozent erreicht hat. Man könnte hinzufügen, dass das gegen eine ÖVP erreicht wurde, die der linken Forderung nach mehr Kindergartenplätzen und Gesamtschulen erst ganz zuletzt nachgegeben hat.
Aber auch abseits der erhöhten Beschäftigung von Frauen ist die Beschäftigungslage hervorragend: Die Arbeitslosigkeit liegt nach internationaler Definition bei nur 4,8 Prozent. Besser liegen unter den starken Ländern des “Nordens” nur Deutschland und Holland mit einer Arbeitslosigkeit von 2 und 3,1 Prozent. Beide Länder sind, wie Österreich, voran wegen des Mangels qualifizierte Arbeitskräfte, kaum mehr in der Lage, die Auftragsflut zu bewältigen, der sie gegenüberstehen.
Scheinbar die perfekte Wirtschaftslage. Nur dass die Reallöhne großer Teile der Bevölkerung aller drei Länder gefallen sind und ihre Armutsgefährdung in jüngerer Zeit nie höher war. “Seit dem Jahr 2000”, sagt ein Bericht der OECD, “haben in Deutschland Einkommensungleichheit und Armut stärker zugenommen als in jedem anderen OECD Land. Hinsichtlich der Primärverteilung lässt sich sowohl ein rapider Rückgang des Anteils der Löhne am gesamten Volkseinkommen feststellen als auch eine zunehmende Ungleichverteilung innerhalb der Lohneinkommen”. Ähnliches gilt für Holland und Österreich: Der Anteil der Löhne am BIP ist in dem Ausmaß gesunken, in dem der Anteil der die Gewinne gestiegen ist, und nicht anders hat der Abstand zwischen niedrigen und hohen Einkommen zugenommen. Alle drei Volkswirtschaften haben nicht deshalb so viele Aufträge, weil sich ihre Bevölkerung immer mehr kaufen kann – sie kann im Gegenteil immer weniger kaufen, weil ihre Löhne seit 23 Jahren nicht mehr wie davor um Produktivitätszuwachs plus Inflation gestiegen sind.
Aber genau dadurch sind ihre Waren unschlagbar preiswert und haben den Volkswirtschaften, die keine “Lohnzurückhaltung” – kein Lohndumping- geübt haben, durch 23 Jahre Marktanteile weggenommen und all die Aufträge hinzugewonnen, die deren Unternehmen verlieren mussten.
Entsprechend groß ist dort die Arbeitslosigkeit: in Frankreich liegt sie offiziell bei 7,3 Prozent, nur dass viele Menschen die Arbeitsuche schon aufgegeben haben, während die Arbeitslosigkeit der 15 bis 24 jährigen 17 Prozent erreicht. In Italien gibt es 8 Prozent Arbeitslose und 22 Prozent sind unter 24. Und in Spanien mir der größten Zahl qualifizierter Arbeitskräfte der EU liegt die allgemeine Arbeitslosigkeit bei 12,8 Prozent und erreich unter 15 bis 24jährigen gespenstischen 29 Prozent – gegenüber 5,7 Prozent in Deutschland.
Man kann, wie voran in Deutschland, die eigene Lohnpolitik für optimal halten – oder in ihr wie der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stieglitz eines der zentralen Probleme der Wirtschaft sehen.
Die globalen außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte, laut Stiglitz “nicht zuletzt auf die Wirkungen zunehmender Einkommensungleichheit in den einzelnen Ländern zurückführen”. Folgt man dieser Analyse, bedarf es – insbesondere auch in Deutschland – einer gleichmäßigeren Einkommensverteilung, um die latente Nachfrageschwäche und damit die gesamtwirtschaftliche Krisenanfälligkeit zu überwinden.
Diese Schlussfolgerung steht im Widerspruch zu gängigen wirtschaftspolitischen Empfehlungen in Deutschland. Diese bleiben bisher weitgehend einer Prä-Krisenstrategie mit Forderungen nach Lohnzurückhaltung und größerer Lohnspreizung verhaftet, d
Der im internationalen Vergleich außergewöhnlich star-ke Anstieg der ökonomischen Ungleichheit in Deutsch-land während des letzten Jahrzehnts ist mittlerweileausführlich dokumentiert. War Deutschland (Österreich) in der Vergangenheit traditionell
in geringerem Ausmaß von Einkommensungleichheit und -armut betroffen als der Durchschnitt der OECD-Länder,so ist es in den letzten Jahrzehnten zu einer
drastischen Verschärfung der Ungleichheit gekom-
men: „
deutschen Banken standen nach den vielfältigen
Deregulierungsmaßnahmen im letzten Jahrzehnt un-
ter erheblichem Renditedruck und wandten sich bei
schwacher Kreditnachfrage im Inland zunehmend der
Spekulation mit riskanten Produkten im Ausland zu. Im
Ergebnis wurden die deutschen Banken – ebenso wie
die deutsche Exportindustrie – stark von der amerikani-
schen Immobilienkrise erschüttert.
Schlussfolgerungen
Die Weltwirtschaftskrise erzeugt für die Zukunft eine
Reihe von schwierigen gesamtwirtschaftlichen Her-
ausforderungen, die zwar von einigen Autoren seit lan-
gem erkannt wurden, 62 aber erst mit der globalen Wirt-
schaftskrise ins allgemeine Bewusstsein gerückt sind.
Es geht um nichts weniger als die Suche nach globaler
wirtschaftlicher Stabilität durch internationale Koopera-
tion.
Wie von Fitoussi und Stiglitz 63 ausgeführt, lassen sich
die globalen außenwirtschaftlichen Ungleichgewich-
te nicht zuletzt auf die unterschiedlichen Wirkungen
zunehmender Einkommensungleichheit in den einzel-
nen Ländern zurückführen. Folgt man dieser Analyse,
bedarf es – insbesondere auch in Deutschland – einer
gleichmäßigeren Einkommensverteilung, um die latente
Nachfrageschwäche und damit die gesamtwirtschaftli-
che Krisenanfälligkeit zu überwinden.
Diese Schlussfolgerung steht im Widerspruch zu gän-
gigen wirtschaftspolitischen Empfehlungen in Deutsch-
land. Diese bleiben bisher weitgehend einer Prä-Kri-
senstrategie mit Forderungen nach Lohnzurückhaltung
und größerer Lohnspreizung verhaftet, die keines der
derzeitigen Probleme lösen, dafür aber die Gefahr wei-
terer Instabilitäten hervorrufen. Sie beruhen zudem auf
empirisch fragwürdigen und teilweise widersprüchli-
chen Argumentationen. Statt eines „Weiter so“ bzw. ei-
ner „Erhöhung der Dosis“ sollte es zu einem – möglichst
international koordinierten – Richtungswechsel in der
Lohn- und Verteilungspolitik kommen. Dies ist eine we-
sentliche Voraussetzung für die künftige Stabilität der
globalen Wirtschaft.
63 J. P. Fitoussi, J. Stiglitz, a.a.O.
scheidend mit befördert hat. 55 Anders als in den USA ist
es in Deutschland in der jüngeren Vergangenheit nicht
zu einem nennenswerten Anstieg der Verschuldung
der Privathaushalte relativ zu ihren Einkommen gekom-
men. 56 Vielmehr hat ein Großteil der Bevölkerung auf
fallende Reallöhne und die sozialpolitischen Einschnitte
der vergangenen Jahre mit Konsumverzicht reagiert. 57
Neben der offenbar ausgeprägten sozialen Norm der
vorsichtigen persönlichen Finanzplanung, die auf die
Kreditnachfrage wirkt, sind auch die Kreditvergabe-
praktiken deutscher Banken traditionell eher konserva-
tiv. 58 Im Ergebnis ist für Deutschland, im Unterschied
zu den USA, kaum ein signifikanter Vermögenseffekt
auf den privaten Konsum zu beobachten; die Haushalte
finanzieren ihren Konsum ganz überwiegend aus den
laufenden Einkommen.
Selbst während des letzten Aufschwungs sind aber die
real verfügbaren Einkommen bzw. die Nettolohnsumme
nicht mehr gestiegen. Die Reallöhne sind sogar wäh-
rend des Aufschwungs gefallen, eine in der Geschich-
te der Bundesrepublik einmalige Entwicklung. 59 Der
private Verbrauch ist dieser stagnativen Einkommens-
entwicklung bestenfalls passiv gefolgt. Zwar wurden
durch die schwache Lohnstückkostenentwicklung die
internationale Wettbewerbsfähigkeit und somit die Ex-
porte befördert. Zugleich folgte aber aus der Einkom-
mensumverteilung gleichsam mechanisch ein Anstieg
der privaten Sparquote, da die oberen Einkommens-
gruppen einen deutlich größeren Teil ihres Einkom-
mens auf die Ersparnis verwenden als die unteren
Einkommensgruppen. 60 Dies schwächte die Entwick-
lung der Binnenwirtschaft. Nicht nur dürfte der Netto-
effekt von Exportsteigerungen und Konsumstagnation
auf das Wachstum in einer großen Volkswirtschaft wie
Deutschland negativ ausgefallen sein. 61 Auch beding-
te diese Entwicklung hohe Kapitalexporte und somit
eine starke Auslandsorientierung des Bankensystems.
im Februar 2023 verzeichnet Spanien mit rund 12,8 Prozent die höchste Arbeitslosenquote innerhalb der Europäischen Union (EU-27). Im Durchschnitt sind 6 Prozent der EU-Bürgerinnen im Februar 2023 als arbeitslos registriert, während die durchschnittliche Arbeitslosenquote in den Ländern der Eurozone² mit rund 6,6 Prozent, signifikant höher liegt. In Deutschland, Polen und Tschechien herrscht mit Arbeitslosenquoten zwischen 2,4 bis 2,9 Prozent nahezu Vollbeschäftigung.
Jugendarbeitslosigkeit 29% Arbeitslosigkeit 26% im Jahr 2013 aber nur 8,3 % 2007
Der Ausfuhrüberschuss im Handel mit Spanien belief sich im Jahr 2021 auf rund 9,75 Milliarden Euro. Der Gesamtwert der deutschen Exporte nach Spanien lag damit um 9,75 Milliarden Euro höher, als die spanischen Importe nach Deutschland.
Im Jahr 2022 hat die Arbeitslosenquote in Italien geschätzt rund 8,09 Prozent betragen. Für das Jahr 2023 wird die Arbeitslosenquote in Italien auf rund 8,30 Prozent prognostiziert Jugendarbeitlosigkeit zwischen 15 und 24 Jahren…..22,3%
2023 Laut den Daten des italienischen Statistikamts Istat exportierte Italien Waren im Wert von 77,5 Milliarden Euro nach Deutschland (ein Plus von 15,8 Prozent). Der Import aus der Bundesrepublik wuchs sogar um rund 20 Prozent – und steigt damit auf 91 Milliarden Euro.