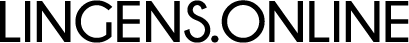Dass Andreas Babler es für nützlich hält, die Welt durch eine marxistische Brille zu betrachten, habe ich noch verstanden, auch wenn mir lieber gewesen wäre, er hätte die Worte „gelegentlich auch“ vor der „Brille“ eingefügt – Karl Marx war auch für mich ein scharfer Beobachter des Wirtschaftsgeschehens.
Aber schon als Andreas Babler erklärte, „Marxist“ zu sein, war er für mich nicht mehr wählbar. Marxens zentrale Thesen sind ja nicht nur falsifiziert, sondern Karl Popper hat in „Die offene Gesellschaft und Ihre Feinde“ auch eingehend begründet, wieso sie als Kommunismus in absolut allen Ländern, von Russland bis China, von Kuba bis Venezuela zu Diktaturen führten, die neben Millionen Verhungerter auch Millionen Ermordeter verantworten. Ein politisch gebildeter Mensch kann heute kein Marxist/Kommunist mehr sein, auch wenn er Marx als Ökonomen respektiert.
Allerdings habe ich unter den Linken, die gelegentlich Marxens Vokabular gebrauchen, mit Ausnahme des verstorbenen Politwissenschaftlers Norbert Leser noch keinen getroffen, der auch Marx` Schriften gelesen hat – und Leser war Antimarxist. Insofern braucht man die Kommunisten Elke Kahr in Graz und Kai Michael Dankl in Salzburg nicht zu fürchten: Sie haben, wie vermutlich auch Babler, kaum eine Ahnung, wozu sie sich in der Theorie bekennen- was sie in der Praxis fordern, ist auch nicht kommunistisch und Diktaturen lehnen sie glaubwürdig ab. Ich wundere mich nur, dass jemand so Intelligenter wie Dankl seine Partei nicht lieber „Linke plus“ nennt.
Seit es das Video gibt, in dem der47 jährige – nicht der 17 jährige – Babler der EU nachsagt, ein „neoliberalistisches, protektionistisches, amerikanisches Konstrukt der übelsten Art und Weise“ und „das aggressivste außenpolitische militärische Bündnis“ zu sein, „das es je gegeben hat“, sehe ich in ihm allerdings doch eine echte Gefahr: Merkt denn ein Peter Menasse nicht, wie nahe Bablers EU-Bild dem Herbert Kickls ist? Hat er je überlegt, wie ein Kanzler Babler zur Bewaffnung der Ukraine durch die EU stünde?
Ich habe etwas Neues über Österreichs „linke Intellektuelle“ gelernt: links zu sein, reicht ihnen völlig. Für sie ist „Links“ ist eine Sache des Glaubens, nicht des Nachdenkens.
Doskozil sagte jedenfalls sofort, was er anstrebt: Rot-Grün Pink. Seine wirtschaftlichen Forderungen unterscheiden sich wenig von denen Bablers und beraten wird er offenbar von Christian Kern, dem ich hier schon immer die größte ökonomische Kompetenz bescheinigt habe.
Biden stärkt Trump.
Joe Biden hat sich wie erwartet im letzten Moment mit den Republikanern geeinigt, die Staatsschuldengrenze anzuheben. Denn zumindest ihrem Sprecher, Kevin McCarthy war klar, dass „Zahlungsunfähigkeit“ neben einer Weltwirtschaftskrise (die seine Radikalen kalt gelassen hätte) auch die größte Wirtschaftskrise der USA seit 1929 ausgelöst hätte – das hat er verhindert. Wohl aber gelang es den Republikanern, Joe Biden neuerlich zu schwächen: Er musste seine schon vielfach gekürzten Investitionen neuerlich erheblich kürzen. Da die Zinserhöhung der FED die Inflation gleichzeitig weniger als die Wirtschaft bremst, wird Biden 2024 bei der Wahl kaum mit Wirtschaftsdaten punkten können, die die Ära Trump in den Schatten stellen. Und Trump, nicht Floridas Gouverneur Ron DeSantis, wird Bidens Gegner sein. Denn nicht nur geriet DeSantis Wahlkampf-Auftakt bei Twitter zum Fiasko, sondern er wird dem Show Profi Trump in den kommenden Vorwahl-Konfrontationen genauso klar unterliegen, wie 2016 Floridas Gouverneur Jeff Bush.
Dass der um Jahrzehnte älter wirkende Biden Trump 2024 abermals schlägt, obwohl Stagflation herrschen dürfte, ist daher alles eher als gewiss. Wenn ihn die Strafjustiz nicht doch rechtzeitig aufhält, gibt es meines Erachtens ein 49 prozentiges Risiko, dass die freie Welt 2025 neuerlich mit Trump als US-Präsident konfrontiert ist. Nur dass er, der schon in seiner ersten Amtszeit am Sinn des transatlantischen Bündnisses zweifelte, ihm in seiner zweiten Amtszeit noch kritischer gegenüberstehen wird. Jedenfalls käme es einem Wunder gleich, wenn Trump die Verteidigung Europas gegen Putins Russland garantierte. Als Ukrainer, aber auch als Este, Lette, Georgier oder Moldawier sähe ich seiner Amtszeit jedenfalls mit panischer Angst entgegen. Und selbst wenn man die Chance, dass Trump die Wahl gewinnt, geringer als ich einschätzt, ist das Risiko, sich dabei zu irren, doch so groß, dass ich nicht verstehe, wie wenig sich die EU auf einen solchen GAU vorbereitet.