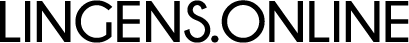Mit Standing Ovations feierte – bedauerte- das Publikum Sonntag Abend die letzte Vorstellung von “Wie im Himmel” im Theater der “Kulturszene Kottingbrunn”: Eine brillante Inszenierung (Anselm Lipgens) der Theaterfassung des berühmten schwedischen Films von Kay Pollak; erstklassige Profi-Schauspieler (Alexander Rossi, Georg Kusztrich, Franziska Hetzel,) und kaum schwächere Laien; ein perfektes Bühnenbild in einem der wahrscheinlich schönsten Theater Österreichs.
Das hat insofern mit Wirtschaft und Politik zu tun, als es zeigt, was “Privatinitiative”, “kluges wirtschaftliches Agieren” zu bewirken vermag, wenn es auf Verständnis der zuständigen Politiker trifft.
Es baucht “Gründer”
Gegründet wurde die Kulturszene 1987 nicht von einem Künstler, sondern einem Unternehmer mit Liebe zur Kunst- dem Techniker Joachim Künzel. Der verliebte sich in das prachtvolle Wasserschloss des Ortes und kämpfte und spendete für seine Restaurierung. Als die Gemeinde der von ihm begründeten “Kulturinitiative” einen verfallenen Stall und die zugehörige Tränke- überließ, organisierte er, dass sie in tausenden freiwilligen Arbeitsstunden zu einem Theater für 250 Zuschauer samt perfekter Eingangshalle umgebaut (in Wahrheit nahezu alles neu gebaut) wurden. Und dass das mit ungeheurem Geschmack geschah: Teile der alten Mauern wurden sichtbar erhalten, die alte hölzerne Dachkonstruktion wurde durch eine ähnlich schöne, statisch perfekte, ersetzt- ich kenne in Österreich allenfalls ehemalige Schlosstheater, die sich mit diesem an Schönheit, nicht aber Funktionalität vergleichen lassen.
Schon wenig später zeigte man mit dem “Mann von La Mancha” die erste Eigenproduktion, in der Profi- Schauspieler durch Amateure perfekt – und preisgünstig unterstützt wurden. Seither gibt es diese Eigenproduktion jedes Jahr – zuletzt eben “Wie im Himmel”. Ich habe am Burgtheater ungleich weniger professionelle Aufführungen gesehen, deren Bühnenbilder das Hundertfache gekostet haben und weit wenige überzeugten. Wie Anselm Lipgens auch seine Laiendarsteller führt, erreicht in seiner Qualität Peter Grubers Nestroy-Spiele
Politik, die den wirtschaftlichen Wert von “Kultur” begreift
Irene Künzel, die den Verein “Kulturszene” seit dem Krebstod ihres Mannes im Jahr 2012 als Obfrau führt, ist wie ein perfekter Kulturmanager: Sie weiß, wie sie leichte Unterhaltung, Musik, Cabaret Kleinkunst mit großen Stücken mischen muss, um ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Bereits 1996 gab es 30 Spieltage – jetzt sind es 150.
Die Marktgemeinde und das Land Niederösterreich begriffen, welche Chance die “Kulturinitiative” darstellt: Landesfürst Erwin Pröll war zu Subventionen bereit – man muss ihm zugestehen, wie kein anderer den wirtschaftlichen (und politischen) Wert von Investitionen in “Kultur” begriffen zu haben.
Mittlerweile wird aus Gemeinde und Landesmitteln der gesamte ehemalige Wirtschaftshof des Schlosses restauriert und es entsteht eine kulturelle “Begegnungszone” von einer Schönheit, die ihresgleichen sucht.