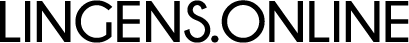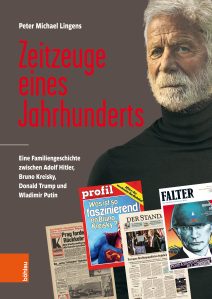Eine späte Einigung kostet Geld – eine falsche kostet Jobs. 11,6 Prozent mehr Lohn verteuert Waren. Erhöht die EZB deshalb die Zinsen, vertieft sie die Rezession.
Nach einer Woche Streik haben die Arbeitgeber der metalltechnischen Industrie und die Gewerkschaft vergangenen Montag ihre Verhandlungen wieder aufgenommen. Meines Erachtens wäre es keine Niederlage für die Gewerkschaft, wenn die Einigung in etwa zwischen ihrer Forderung nach 11,6 Prozent mehr Lohn und dem bisher letzten Angebot der Arbeitgeber über 6 Prozent plus 1.200 Euro Einmalzahlung läge, die sie mittlerweile offenbar als Lohnerhöhung über 8,2 Prozent auszuzahlen bereit ist. Weil das im Widerspruch zu Überlegungen steht, die ich hier mehrfach geäußert habe, will ich es ausführlich begründen.
Der erste Grund ist banal und illustriert die Argumentation des Verhandlungsführers der Arbeitgeber Stefan Ehrlich-Adám am “Runden Tisch” des ORF: Österreichs metallverarbeitende Industrie muss im Export, der 80 Prozent ihres Geschäfts ausmacht, mit der metallverarbeitenden Industrie anderer Länder, voran Deutschlands, konkurrieren. Dort fordert die Gewerkschaft soeben eine Lohnerhöhung von 8,5 Prozent, die sie, wenn auch nicht allzu energisch, mit der Forderung nach 32 statt 35 wöchentlichen Arbeitsstunden verknüpft. Die Arbeitgeber setzen dem ein Angebot von 3,1 Prozent mehr Lohn mit einer Laufzeit von 15 Monaten und eine Einmalzahlung entgegen und lehnen eine Arbeitszeitverkürzung angesichts des Fachkräftemangels kategorisch ab. Wenn ich den Kompromiss abschätze, den man in Deutschland finden dürfte, so wird er kaum viel anders aussehen als die eingangs von mir empfohlene Einigung in Österreich. Deutlich höhere Löhne als Deutschland können wir uns nämlich kaum leisten, denn in der metallverarbeitenden Industrie sind sie für 30 bis 40 Prozent der Kosten einer Ware verantwortlich.
In beiden Ländern kämpft die exportorientierte Industrie, für die der Abschluss der Metaller noch dazu Vorbild ist, zudem mit einer Rezession: Die Auftragseingänge sind massiv zurückgegangen. Natürlich muss es die Chefökonomin des ÖGB Helene Schuberth empören, dass Unternehmen, die im zurückliegenden sehr guten Jahr, in dem sie die Inflation nicht selten zur Ausweitung ihrer Gewinnmargen nutzten, hohe Dividenden zahlten, nun erklären, die geforderte Lohnerhöhung nicht zu verkraften. Aber dann waren die vergangenen Lohnforderungen der Gewerkschaft leider nicht energisch genug – für das gegenwertige Konkurrenz- Problem ist das irrelevant: Wenn die Lohnstückkosten bei uns deutlich höher als in Deutschland oder der Schweiz ausfallen, wird das Problem der Betriebe unweigerlich zum Problem entlassener Arbeitnehmer.
Anders bei den Bäckern, die nur im Inland mit inländischen Bäckern konkurrieren
Es gibt aber einen zweiten Grund, warum die von mir sonst so geschätzte Benya-Formel in der aktuellen Situation nicht ausschließliche Basis der Lohnforderung sein kann. Sie lautet bekanntlich, dass eine Lohnerhöhung das Ausmaß der durchschnittlichen Inflation des zurückliegenden Jahres zuzüglich des erzielten Produktivitätszuwachses haben soll und das hat folgenden ökonomischen Sinn: Die Bevölkerung erzielt auf diese Weise einen Lohn- und Kaufkraftzuwachs, der sie theoretisch in die Lage versetzte, alle Waren, die ihre Volkswirtschaft auf Grund des Produktivitätszuwachses in Summe mehr erzeugt hat, auch zu kaufen, obwohl sie sich im Ausmaß der Lohnerhöhungen des abgelaufenen Jahres verteuert haben. Praktisch kauft sie natürlich auch Waren fremder Volkswirtschaften, aber wenn alle Volkswirtschaften gemäß der Benya-Formel agieren, gleicht sich das aus. Dass Österreich, Deutschland, Holland und die Schweiz seit 2000 nicht mehr so agieren, habe ich hier als eines der existentiellen ökonomischen Probleme der EU gebrandmarkt und insofern machten hohe Lohnabschlüsse in Österreich und Deutschland durchaus Sinn.
Dass es dennoch problematisch ist, ihre Höhe nach der Benya-Formel zu berechnen, indem man zu 2 Prozent Produktivitätszuwachs 9,6 Prozent Teuerung des abgelaufenen Jahres addiert, liegt daran, dass diese Teuerung nicht wie in der Vergangenheit aus Lohnerhöhungen resultiert und damit im Idealfall bei rund zwei Prozent lag, sondern aus der außergewöhnlichen Verteuerung der Energie durch Wladimir Putin. Nur ist diese Teuerung, nicht zuletzt weil es sich um ein so untypisches, fast einmaliges Ereignis gehandelt hat, Gott sei Dank mittlerweile EU-weit schon wieder auf 2,9 Prozent, in Österreich auf 5,4 Prozent gesunken. (Letzteres liegt an Österreichs extremer Abhängigkeit von russischem Gas – allenfalls am Rande an mangelnder Inflationsbekämpfung durch die schwarz-grüne Regierung.)
Daher macht es mehr Sinn als sonst, den Verlust, den die Metall-Arbeitnehmer im abgelaufenen Jahr durch die extreme Teuerung erlitten haben, durch eine beträchtliche Einmalzahlung der Arbeitgeber abzufedern, die sich zu den Zahlungen der Regierung (abgeschaffte kalte Progression, erhöhte Absetzbeträge, Einmalzahlungen) addiert. Dagegen stellt es ein Problem dar, die Löhne um 11,6 Prozent zu erhöhen, weil es die Inflation doch neuerlich befeuerte, auch wenn sie die Waren derzeit nur mehr um höchstens 5,4 Prozent, wahrscheinlich aber weit weniger, verteuert.
Das aber nähme die ökonomisch leider verwirrte EZB mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Anlass, die Zinsen, die derzeit Gott sei Dank pausieren, doch wieder anzuheben. Damit aber vertiefte sie die Rezession, in die sie uns bereits gestürzt hat, dramatisch.