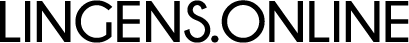Vor 80 Jahren erschien Karl Poppers „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“. Da ich ihn gut kannte, frage ich mich, wie er Trump, die EU oder den Ukrainekrieg sähe.
Wenn Karl Popper, den die ZEIT den bedeutendsten Philosophen des 20.Jahrhunderts nannte, seine Heimatstadt Wien besuchte, hatte ich das Glück, nach dem Tod zweier Jugendfreunde der erste zu sein, den er anrief. Einer der ersten Anrufe erreichte mich 1962, knapp nachdem die Kuba-Krise beinahe zum dritten Weltkrieg geführt hätte, als sich US-Kriegsschiffe sowjetischen Schiffen entgegenstellten, die Raketen zu einer kubanischen Basis bringen sollten. Popper bat mich, zu ihm ins Hotel Ambassador zu kommen, um Briefe an westliche Staatsmänner zu verfassen, die besagten, wie dringlich es sei, Raketen zu besitzen, die ohne Atomsprengköpfe in der Lage wären, Raketen-Basen zu zerstören. Hätte die USA solche besessen, so hätten sie die Basis in Kuba zerstört, ohne dass es zur Konfrontation der Kriegsschiffe gekommen wäre. Solche Aktionen waren typisch für Popper: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, zählte zu seinen Überzeugungen und sie erstreckte sich selbstverständlich auch auf den militärischen Bereich. Gerade weil er den Krieg wie jeder anständige Mensch hasste, war er kein Pazifist. Frieden, so war er überzeugt, war am ehesten durch militärisches Gleichgewicht zu sichern, aber im Idealfall sollte die anständige Partei, und das waren für ihn die USA, ihrem Gegner überlegen sein.
Ich habe daran denken müssen, als ich die aktuellen Aufrufe der Friedensbewegung zu „Ostermärschen“ vernommen habe, mit denen gegen die massive Erhöhung der europäischen Rüstungsetats demonstriert werden sollte – Popper sähe in ihnen einen Beitrag zu der Gefahr, dass Wladimir Putin nach der Ukraine ein weiteres Land angreift. Er war nie ein „Idealist“, sondern ein idealistischer Realist: dem Frieden verpflichtetes, aber rationales Denken ging ihm über alles. Wenn dieses rationale Denken dazu führte, sich stärker zu bewaffnen – Popper war zu Recht der Ansicht, dass es viel eher zu konventionellen als zu atomaren Kriegen kommen würde – dann hatte man sich für diese stärkere Bewaffnung einzusetzen. Ich bin absolut sicher, dass er sich eine militärisch starke EU gewünscht hätte.
Die Entwicklung in den USA hätte ihn ebenso sicher entsetzt. Mit Donald Trump stellt die republikanische Partei das Fundament der „offenen Gesellschaft“ in Frage, indem fundamentalistisch evangelikales oder von bloßer Gier beherrschtes Denken rationales Denken und Verhalten ablösen. Am meisten erschütterte Popper, dass die Unterscheidung zwischen „richtig “ und „falsch“, zu der er mit der „Logik der Forschung“ einen entscheidenden Beitrag geliefert hat, unter Trump keine Bedeutung mehr hat: Er konnte noch so oft gelogen haben und wurde dennoch wiedergewählt. Wenn diese Unterscheidung nicht mehr angestrebt wird, ist rationales Denken und Handeln nicht mehr möglich.
Poppers Forderung wahrheitsgemäß zu agieren war unerbittlich: Als ihn eine ORF- Angestellte im Sendestudio bat, noch rasch für sie zu unterschreiben, dass er das Honorar erhalten hätte, das ihm nach der Sendung übergeben würde, weigerte er sich energisch: „Ich unterschreibe nichts Unwahres. Ich werden unterschreiben, nachdem ich das Honorar erhalten habe“. Nachsatz: „Solche unwahren Bestätigungen sind die Basis des AKH-Skandals.“ Ich lachte damals und meinte, er müsse doch nicht ganz so streng sein. Aber das Problem ist, dass wir jegliche Strenge abgelegt haben: Dass Sebastian Kurz im U-Ausschuss nicht ganz die Wahrheit sagte, finden viele nicht so schlimm; der Ex-Präsident des Nationalrats Wolfgang Sobotka wollte die Wahrheitspflicht im U-Ausschuss abschaffen. Keinen FPÖ- Wähler stört, dass die FPÖ die Neutralität als unverzichtbar erklärt, obwohl sie es war, die Österreichs Beitritt zur NATO forderte oder dass Herbert Kickl, der den Bundestrojaner als Innenminister einführen wollte, ihn jetzt heftig ablehnt. Friedrich Merz ist erste Wahl der CDU-CSU für die deutsche Kanzlerschaft, obwohl er die Staatsschuldenbremse, die er im Verein mit SPD und Grünen soeben zu Recht außer Kraft setzte, noch kurz zuvor unverzichtbar nannte, als die Ampel-Regierung sie in Frage stellte.
Selbst im Bereich der Wissenschaft wird Poppers Prinzip, dass falsch ist, was falsifiziert wurde, negiert: Es kann sich noch so oft zeigen, dass Volkswirtschaften mit hohen Staatsschuldenquoten wie Japan oder die USA tadellos wachsen, und die EU hält dennoch daran fest, dass mehr als 60 Prozent schädlich wären – und Dutzende Ökonomen unterstützen es, so dass es Maxime der Kommission bleibt. Popper war als Mitglied der Mont Pellerin- Gesellschaft, auch wenn er nur einmal an ihrem Meeting teilnahm, kein Anhänger einer vom Staat dominierten Wirtschaft, aber wenn sich erwiesen hätte, dass höhere Staatsverschuldung nötig ist, um Wachstum zu generieren, so hätte er sie mit absoluter Sicherheit befürwortet (auch wenn er in Frage gestellt hätte, dass Wachstum dauerhaft möglich ist.)
Mit absoluter Sicherheit wäre ihm der Erfolg der EU heute so wichtig wie nie zuvor gewesen, Ist sie doch derzeit wichtigster Hort jener „offenen Gesellschaft“, für die er sich so sehr eingesetzt hat. Im Übrigen war er ein Optimist: er war zuversichtlich, dass sich die „offene Gesellschaft“ als bestes Modell einer Gesellschaft erweisen würde. Dass sie sich deshalb weltweit durchsetzen müsse, schien ihm allerdings in keiner Weise gewiss. „Wir müssen ständig um die offene Gesellschaft kämpfen“ – „denn „es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“