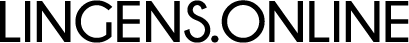Der überraschende Sinneswandel Donald Trumps bewahrt die Ukraine vor der drohenden Niederlage. Ihren Erfolg behindern EU-Rechtsruck, Schuldenbremse und Friedensbewegte.
Bereits seit einem Jahr konfrontieren mich russische Freunde mit der wachsenden Enttäuschung, dass der “Westen” der Ukraine nur so zögerlich schwere Waffen und nicht einmal genug Munition liefert, “denn dass Putin diesen Krieg verliert, ist unsre einzige Chance, ihn loszuwerden.” Bis zum letzten Wochenende konnte ich ihrem Pessimismus immer Weniger entgegensetzen-ich sah die Ukraine den Krieg verlieren. Donald Trumps überraschender Sinneswandel, stimmt deshalb optimistisch, weil er der Ukraine auch dann eine Chance gibt, wenn er Joe Biden ablösen sollte.
Auch in Bidens Team gibt es Politiker, die die Chance sehen, dass Putin über eine Niederlage in der Ukraine stürzt. Doch Biden selbst ist vorsichtiger – und ich bin es mit ihm: der “Westen” muss nur alles tun, damit Wladimir Putin diesen Krieg nicht gewinnt. Der nicht nur semantische Unterschied: es ist zwar höchst unwahrscheinlich, aber nicht absolut ausgeschlossen, dass Putin doch zu Atomwaffen greift, ehe er den Krieg offenkundig verliert. Das will Biden nicht riskieren und so hat er im Einklang mit seiner der kriegsmüden Bevölkerung immer erklärt, keine Truppen zu entsenden. Damit ließ er Putin auch immer einen gesichtswahrenden Ausweg, den der freilich nur suchen wird, wenn die Ukraine ihn militärisch dazu zwingt: wenn er über einen Frieden verhandeln muss, bei dem er ihr Terrain samt Donbass räumt, die Krim aber russisch bleibt -schließlich hat Nikita Chruschtschow sie der Ukraine 1954 ohne Volksabstimmung geschenkt. So problematisch dieser Verhandlungsfriede auch wäre, weil er Putins Aggression unverändert belohnte, scheint er mir doch die einzige realistisch Chance, ein fortgesetztes Blutbad zu vermeiden.
Derzeit kann von Verhandlungen freilich nicht die Rede sein – viel eher ist zu fürchten, dass die Ukraine den Krieg verliert. Sie hat nun einmal nur 38 Millionen Einwohner, gegenüber 144,2 Millionen Einwohnern Russlands. Nur überlegene Bewaffnung hätte dieses Manko beseitigt, doch diese Möglichkeit hat Kanzler Olav Scholz vergeben: Deutschland liefert der Ukraine viel zu spät die schweren Panzer, die ihre Sommeroffensive zum Erfolg geführt hätten. So kann Putin die Infrastruktur der Ukraine weiter erfolgreich zerstören und langsam aber sicher Terrain gewinnen.
Weil Trumps Republikaner die USA bis jetzt blockierten, ermannte sich die EU: sie beschloss ein 50 Milliarden -Hilfspaket und liefert aus Deutschland ein Luftabwehrsystem und aus Tschechien Munition. Zudem schlug Generalsekretär Jens Stoltenberg schlug einen 100 Milliarden-Fonds der NATO vor, um den Nachschub der Ukraine für längere Zeit zu sichern. Ungarns Viktor Orban hat freilich schon Widerstand signalisiert und wenn der erwartete Rechtsruck im EU-Parlament stattfindet, weil Österreich durch mehr FP-Mandatare, Frankreich durch mehr Mandatare Marine Le Pens, oder Deutschland durch mehr AfD -Mandatare vertreten ist, stehen auch weitere EU-Gelder auf vorerst auf ungewissen Beinen. Schon allein der Ukraine wegen müsste man diesen Rechtsruck unter die historischen Katastrophen zählen. Den Hauptgrund dafür sehe ich unverändert im Sparen der Staaten und in der von Deutschland praktizierten Lohnzurückhaltung. Franz Schellhorn von der Agenda Austria hielt mir entgegen, dass die Löhne in der EU doch gestiegen wären – aber leider nur wenn man die Inflation außer Acht lässt. Vor allem hat jene Unterschicht massiv Kaufkraft verloren, aus der die Mehrheit der Wähler von FPÖ, AfD oder Marine Le Pen kommt.
Entscheidend für das Schicksal der Ukraine ist aber zweifellos die Haltung der USA. Bisher hatten die Republikaner ein 61 Milliarden-Hilfspaket bekanntlich im Auftrag des wahlkämpfenden Donald Trump blockiert – aber selbst er kann lernen: Indem er jetzt erklärte, die Unterstützung der Ukraine liege sehr wohl im Interesse der USA, verwarf er alles bisher Gesagte und das Paket wird endlich beschlossen.
Damit auch die EU rechtzeitig und ökonomisch verträglich Ihren Teil zu Waffenlieferungen beitragen kann, braucht es aber nicht nur viel Geld, sondern auch den blitzartigen Ausbau der eigenen Rüstungsindustrie, und der erfordert von den EU-Staaten nicht nur massive Basisinvestitionen, sondern auch die Bereitschaft Jahr für Jahr zwei Prozent des BIP für Rüstung auszugeben, denn die Rüstungsbetriebe brauchen diese Gewissheit, um zu investieren. In Deutschland scheitert diese Bereitschaft gleichermaßen am Widerstand Friedensbewegter, die Aufrüstung zur Verteidigung für Kriegstreiberei halten, wie am Widerstand der FDP, die zwar energisch für Waffenhilfe an die Ukraine eintritt, ihren Wählern aber versprochen hat, die Staatsschulden nicht zu erhöhen. Die CDU-CSU verhält sich diesbezüglich nicht anders als bisher die Republikaner: Sie torpediert das von Olaf Scholz geforderte Aussetzen der Staatsschuldenbremse, weil sie ihn damit vor Probleme stellen kann. So musste seine Regierung bekanntlich eine Mehrbelastung der Landwirtschaft beschließen, um die Schuldengrenze einzuhalten und beschwor damit einen Bauernaufstand herauf. Selbst Mehrausgaben zur Belebung der angeschlagenen deutschen Wirtschaft scheitern an der Schuldengrenze: die widersinnige Schulden-Phobie des Ökonomen Kenneth Rogoff behindert die rasche Überwindung der Rezession nicht anders als die rechtzeitige Waffenhilfe für die Ukraine. Auch ökonomischer Unsinn kann eine historische Katastrophe sein.