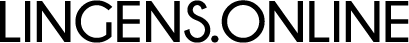Salzburgs Vizebürgermeister Kai -Michael Dankl will Kommunist und Marxist sein, Andreas Babler zumindest Marxist. Ist eine dunkelrote Renaissance denkbar?
Schon bei ihrer ersten Pressekonferenz war klar: Der neue SP-Bürgermeister Salzburgs, Bernhard Auinger und sein Vize Kai-Michael Dankl, der sich als Kommunist und Marxist bezeichnet, sind eine Chance für die Mozartstadt. Auinger, zuvor unglücklicher Vize des erfolglosen VP-Bürgermeisters Harald Preuner, überzeugt durch Sachkenntnis und Erfahrung, Dankl wirkt kaum weniger informiert und denkbar engagiert. Beide lassen keinen Zweifel, dass sie zusammenarbeiten wollen, statt einander politisch zu bekriegen. So sagte Auinger Dankl sofort das von ihm gewünschte Wohnbau-Ressort zu, obwohl das Dankl, sollte er Erfolg haben, zu einem noch schärferen Konkurrenten bei künftigen Wahlen macht. Beiden geht es offenkundig vor allem um die Stadt – und das kommt gut an.
Ist daher denkbar, dass Marxismus und Kommunismus in Österreich eine Renaissance erleben, nachdem sich SP- Obmann Andreas Babler als Marxist geoutet hat, Elke Kahr erfolgreich als kommunistische Bürgermeisterin von Graz amtiert und nun auch Dankl die Chance auf Erfolg hat?
Aufs Erste hat Dankl sehr persönliche Vorzüge: Er wirkt denkbar sympathisch, spricht so verständlich wie intelligent und es macht Eindruck, dass er, wie andere KP-Funktionäre, von seinem Gehalt nur 2400 Euro für sich behält und mit dem Rest Bedürftige unterstützt. Durch Politik nicht reich werden zu wollen, fällt angenehm auf, auch wenn es Dankl noch nicht zu einem guten Wohnbaustadtrat macht, denn Wohnungsnot lässt sich nicht durch Almosen, sondern nur durch mehr sozialen Wohnbau beheben. Das Besondere an Dankl: Man traut ihm diesen vermehrten sozialen Wohnbau zu und niemand fürchtet, dass er zu diesem Zweck das Privateigentum abschaffen wird.
Mein Problem ist: Die regierenden Kommunisten dieser Erde haben das primär immer getan – es bleibt für mich schwer verständlich, wie man heute anständig, intelligent und Kommunist sein kann. In erster Linie weil Kommunismus, wo immer er verwirklicht wurde – von Russland bis China, von Kambodscha bis Kuba mit düsterer Diktatur verbunden war. Dankl sollte es als Historiker am besten wissen: Unter Stalin starben 2,5 Millionen Bürger als angebliche “Konterrevolutionäre” im “Archipel Gulag”, 700.000 wurden hingerichtet; Mao Tse Tungs “Kulturrevolution” kostete mindestens 1,5 Millionen Chinesen das Leben; Pol Pots rote Khmer brachten in Kambodscha zumindest 1,7 Millionen Menschen um; in Kuba wird bis heute gefoltert (ich könnte Dankl mit Opfern bekannt machen). Als man Dankl auf die Diktatur Wladimir Putins ansprach, reagierte er freilich so glaubwürdig wie geschickt: Sympathien für Putin würde man eher bei der Wirtschaftskammer oder der FPÖ finden.
Allerdings hat der Kommunismus immer auch wirtschaftlich total versagt, sofern er nicht, wie in China, aufhörte, kommunistischen Maximen zu folgen: In der Sowjetunion verhungerten sieben Millionen, als die Landwirtschaft verstaatlicht wurde, in Kambodscha Hunderttausende, in Kuba gibt es soeben eine Hunger-Revolte. Theoretisch könnte Dankl sich freilich auch von der Staats- und Planwirtschaft des Kommunismus distanzieren: Sie ist kein Gebot des Marxismus, sondern eine Erfindung Lenins. Weil Karl Marx nie sagte, was er unter der von ihm geforderten “Vergesellschaftung” der Produktionsmittel versteht, erklärte Lenin, man hätte darunter “Verstaatlichung” zu verstehen. Da die kommunistische Partei den Staat beherrschte, beherrschte sie die “Produktionsmittel”, und da staatliche Funktionäre mittels Anordnung agieren, herrscht im Kommunismus Planwirtschaft.
Indem er sich, Lenin negierend, auf Marx zurückzieht, könnte Dankl dem Vorwurf entgehen, das kommunistische Wirtschaftsmodell zu vertreten. Allerdings ist es auch nicht ganz leicht, heute Marxist zu sein. Marx war zwar ein für seine Zeit fortschrittlicher Ökonom und erkannte viele dem Kapitalismus eigene Gefahren richtig- etwa das Streben nach Monopolen -, aber er sah auch vieles falsch – etwa, dass Unternehmen keine fallende Profitrate akzeptieren könnten. Sein zentraler Fehler war freilich die Überzeugung, dass der Wirtschaft ein “ehernes Gesetz” innewohne, wonach es zum Klassenkampf zwischen ausgebeutetem Proletariat und besitzender Bourgeoisie kommen müsse, den das Proletariat gewänne, um via “Vergesellschaftung” zur klassenlosen Gesellschaft zu gelangen. Gewerkschaften, wie sie zu seiner Zeit in England erste Erfolge errangen, lehnte Marx ab: Sie würden durch “Scheinerfolge” den Sieg des Sozialismus nur verzögern. Tatsächlich hat es in kommunistischen Staaten nie Gewerkschaften gegeben – “Solidarnosc” in Polen entstand gegen die kommunistische Partei.
Ich frage mich, ob den “Marxisten” Babler, Kahr oder Dankl dergleichen bewusst ist? Jedenfalls habe ich in Österreich bisher nur einen Menschen, den Politologen Norbert Leser gekannt, der Marxens Werk auch gelesen hatte und Marx` zentrale These bei aller Wertschätzung des Ökonomen Marx, energisch ablehnte. Eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Marxismus hat in der SPÖ nach dem Krieg nie stattgefunden – man hat sich damit begnügt, gelegentlich marxistische Vokabel zu nutzen, kaum aber marxistisch oder kommunistisch zu handeln. Ich glaube, dass das bei Dankl, Kahr oder Babler nicht viel anders ist: Sie wollen gute sozialdemokratische Politik machen. Sollte es tatsächlich zu einer Renaissance von Kommunismus und Marxismus kommen, dann indem beides verkannt wird.