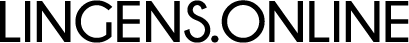Hiermit warne ich vor dem Besuch des Burgtheaters: Die Bühnenbilder sind trotz Explosionen und Feuerspielen ermüdend langweilig; man versteht die Texte schon ab der achten Reihe nicht mehr, weil die aus München importierten Schauspieler extrem schlecht sprechen; und der Regisseur Martin Kusej hat eine zutiefst provinzielle Angst davor, dass seine Inszenierungen “normales” Theater sein könnten, das auch “Bildungsbürgern” gefällt.
Ich fürchte, das Burgtheater hat sich mit seiner Bestellung etwas angetan.
Ein Burg -Intendant, der große Hoffnungen weckte
Dabei habe ich dieser Bestellung mit der größten Hoffnung entgegengesehen, nachdem ich ihn seinerzeit als Gastregisseur von Grillparzers “König Ottokar” erlebt hatte: Da vermochte er die Lesebuch-Langeweile üblicher Inszenierungen tatsächlich mit wuchtiger Pranke zu durchbrechen, machte bis dahin verborgene Erotik sichtbar, nahm der Lobrede auf Österreich ihr patriotisches Pathos und hatte im übrigen Schauspieler zur Verfügung, die man bis in die letzte Reihe verstand. (Elisabeth Orth sowieso; Tobias Moretti nutze angebliche ein Mikrofon wie es Kusejs Münchner Crew zwingend vorzuschreiben wäre.)
Aber in seinen drei aus München mitgebrachten Inszenierungen war von dieser Pranke nichts zu merken – da war davon nur provinzielles Bemühen um “anders sein” übrig.
Akrobatik ersetzt Intensität nicht
Vielleicht noch am wenigsten in “Wer hat Angst von Virginia Woolf”. Da störte nur die schlechte Sprechtechnik und wurde psychische Verkrümmungen all zu oft nur mittels körperlicher Verkrümmungen vermittelt. (Ein von Kusej leider besonders häufig genutztes Regie-Element.) Jedenfalls habe ich dieses Stück schon in ungleich intensiveren Inszenierungen -freilich auch auf ungleich kleineren Bühnen- gesehen.
Im Akademietheater wäre diese Inszenierung vielleicht auch etwas intensiver rübergekommen zumal Bibiana Beglau eine gute Schauspielerin ist.
Fausts fade Vernichtung
Zu einer reinen wirklichen Katastrophe wurde Kusejs Faust 1, beziehungsweise was davon noch übrig war, nachdem er ihn durch den Reißwolf seiner Regie gedreht hatte. Teile von Faust 2 wurden aus völlig unersichtlichen Gründen an völlig unerklärlicher Stelle eingefügt; Goethe wurde überall dort nicht zitiert, wo diese Zitate “Bildungsbürgern” geläufig sind, denn die vor den Kopf zu stoßen war offenbar Kusejs wesentlichstes Anliegen. Auf die Idee, dass Goethe Formulierungen deshalb so bekannt sein könnten, weil sie so vollendet sind, scheint er nicht gekommen.
Das Ganze spielt in einem dunklen Bühnenbild, in dem sich so etwas wie ein riesiger Käfig dreht, aus dem rätselhafte Raketen mit zuckenden Lichtblitzen und gelegentlich ohrenbetäubendem Krach hochsteigen, ohne dass dadurch die geringste Spannung aufkommt – eher schläft man ein. Das gilt auch für die “Orgie” zu der Auerbachs Keller (theoretisch sinnvoll, praktisch erfolglos) umfunktioniert wird: Selten wurde auf offener Bühne so langweilig scheinkopuliert.
Kusejs aus München importierter Faust Werner Wölbern wirkt nie wie ein über die Zusammenhänge der Welt grübelnder Intellektueller, sondern wie ein Wirt des Oktoberfestes, der zu wenig eingenommen hat und durch seinen Beruf zum Alkoholiker geworden ist. Zudem spricht er besonders schlecht.
Bibiane Beglau als Mephisto spricht auch nicht gut, ist aber zumindest präsent, obwohl auch bei ihr die Verrenkungen des Körpers einmal mehr intensiver ausfallen als das teuflisch Verführerische.
Ich halte der Ordnung halber fest, dass Ronald Pohls sich im Standard für diesen Faust begeistert hat- für mich war er die Vernichtung eines Stückes Weltliteratur ohne dass dabei wenigstens die Spannung einer “Vernichtung” – eines Mordes -aufgekommen wäre.
Eine finstere Bühne macht keine finsteren Zeiten
Obwohl dieser Faust Grund genug gewesen wäre, Kusejs Burgtheater für Monate zu meiden, wollte ich mir sicherheitshalber noch seinen “Don Carlos” ansehen, ehe ich vorerst ein letztes Mal über seine Intendanz schreibe.
Der blieb, anders als Goethes Faust, als Schillers Drama erkennbar. Nur die “schönen Tage von Aranjuez ” wurden vermieden um einmal mehr klarzustellen, dass man keinen Wert auf Bildungsbürger legt und um die Bühne auch sogleich in Dunkelheit zu hüllen. Nur zwei Drohnen überfliegen sie mit stechenden Scheinwerfern und sollen offenbar den “Überwachungsstaat” suggerieren, den es schauspielerisch zu vermitteln nicht gelingt, obwohl Nackte in eine Grube mit Wasser gestoßen werden und König Philip gelegentlich jemanden würgt.
Die, durch die viereinhalbstündige Inszenierung – man empfindet sie als zehnstündig- fast lückenlos durchgehaltene Dunkelheit ist deshalb ein zusätzliches Problem, weil man den Schauspielern dadurch nicht auf den Mund sehen kann, um vielleicht von ihren Lippen abzulesen was sie sagen. Denn einmal mehr sind sie schon ab der achten Reihe in ihrer überwältigenden deutschen Mehrheit nicht zu verstehen. (Bei Claus Peymann, der auch deutsche Schauspieler mitbrachte, war das anders – es lag also nicht an meinen österreichischen Ohren.)
Unter diesen Schauspielern war Thomas Loibl als Philip gut gecastet, wenn auch besonders schlecht zu verstehen- manchmal wirkte seine Einsamkeit glaubhaft. Am insgesamt glaubwürdigsten war Nils Strunk als jugendlich verträumter, Don Carlos, auch wenn man ihn nicht an Oscar Werner in dieser Rolle messen durfte. (Das tat ich nicht, ich maß ihn “nur” an August Diehl und da war er trotz passabler Leistung ganz ungleich schwächer)
Ein neuer Burg-Star der nicht sprechen kann
Die eigentliche Katastrophe dieser Inszenierung war Franz Pätzold als Marquis Posa. Margarete Affenzeller normalerweise eine kompetente Kritikerin widmet ihm im Standard eine Hymne als “dem neuen Star des Burgtheaters”. Vielleicht ist er, wie sie schreibt, tatsächlich ein fulminanter Darsteller im Film – am Burgtheater müsste er sprechen können und das konnte er von allen eingesetzten deutschen Schauspielern am wenigsten. Man konnte sich aber auch in keiner Sekunde vorstellen, das er die Fahne der Freiheit durch ganz Europa trug, die Rebellion der Flamen unterstützte oder in der Lage gewesen wäre, Philip mit “Gedankenfreiheit” zu konfrontieren – “Sir” durfte er ihn an dieser Stelle nicht nennen um “Bildungsbürgern” nicht Zucker zu geben.
Ein Besucher neben mir, der die ganze Aufführung hindurch geschlafen hatte, klatschte beim Erwachen dennoch aufs heftigste: Er hat vermutlich Kusej-Kritiken im Standard gelesen.
Mehr Theater für weniger Geld
PS: “Sie sollten wirklich nicht übers Theater schreiben. Bleiben Sie dabei, was sie können.”, ließ mich ein Leser wissen, als ich an dieser Stelle schrieb, Martin Kusej hätte Goethes Faust durch den Regie-Reißwolf gedreht.
Ich füge diese Kritik hier an, weil es sicher am besten ist, wenn Sie sich ihr eigenes Bild von Kusjejs Inszenierungen machen.
Ich für meinen Teil spare vorerst viel Geld – in Sachen Wirtschaft spricht mir der selbe Leser die Kompetenz nicht ab- indem ich ins “Scala Theater” gehe, wo ich in mehreren Jahren noch nie eine schlechte Inszenierung gesehen habe oder suche sonst eines der zahllosen hervorragenden kleinen Theater Wiens auf, die vermutlich das Ganze Jahr weniger Subvention bekommen, wie sie die Burg nur für “Fausts” Bühnenbild ausgegeben hat. Manche, wie Bronski und Grünberg schaffen sogar ohne jede Subvention bessere Klassik-Inszenierungen als die Burg. An der “Freie Bühne Wieden” war der grandiose Schauspieler Johannes Terne als Richard Nixon in Peter Morgans Frost/Nixon perfekt zu verstehen obwohl er ein Deutscher ist. Manche, wie Bronski und Grünberg schaffen bessere Klassik-Inszenierungen als die Burg sogar ohne jede Subvention. Wenn derzeit “Burgtheater”; dann besser dort oder an der Josefstadt.