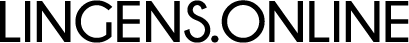Die ÖVP könnte Nehammer nach Brüssel wegloben und jemanden an ihre Spitze hieven, der Blau-Türkis für stimmiger als Rot-schwarz- grün/pink hält. Die SPÖ befördert das.
Bisher habe ich die Horrorvision, dass Herbert Kickl 2024 “Volkskanzler” wird, damit zur Seite geschoben, dass mir ausgeschlossen schien, dass Karl Nehammer ihn dazu macht, hat er doch denkbar eindringlich erklärt, dass das für ihn nicht in Frage kommt. Denn obwohl er sich schützend vor Wolfgang Sobotka stellt, halte ich ihn für einen anständigen Menschen: Was soll er tun, wenn der nicht geht? Dass es ihm nicht und nicht gelingt, die ÖVP wenigstens ein Stück aus ihrem Umfragetief herauszuführen, lässt mich allerdings, je länger es andauert, eine Entwicklung für möglich halten, die mir ein intimer Kenner der ÖVP so beschrieb: Nehammer wird die Wahlschlappe, der die ÖVP entgegengeht, nicht verantworten wollen; mit Österreichs Anspruch auf einen Kommissar in Brüssel böte sich ihm eine Alternative; massive Kräfte (auch Landeshauptleute)innerhalb der ÖVP planten daher, ihn dorthin weg zu loben und jemanden an die Spitze der Partei zu hieven, für den es ein Aufstieg und kein Problem wäre, Vizekanzler(in) einer blau-türkisen Regierung zu sein. Zwar müssten die schwarzen Landeshauptleute damit einen Kanzler Herbert Kickl akzeptieren, aber da alles dafür spreche, dass sie andernfalls einen Kanzler Andreas Babler akzeptieren müssten, sei ihnen Ersterer lieber. Denn leider sei die innere Übereistimmung mit der FPÖ, die man unter Sebastian Kurz erlebt hat, viel größer als mit der SPÖ. Zudem kann die ÖVP in der möglichen Zweierkoalition mit der FPÖ weit mehr Ministerien für sich fordern als in einer Dreierkoalition mit SPÖ und Grünen oder Neos. Viele Funktionäre hielten das blau-türkise Bündnis daher leider für stimmig und erfolgversprechender. Ich habe eingewendet, dass Tirols Anton Mattle oder Vorarlbergs Markus Wallner das schwerlich so sehen und dass die FPÖ zwar grundsätzlich national, wirtschaftlich aber eher sozialistisch ticke, aber mein Gesprächspartner sah in Mattle und Wallner “leider Leichtgewichte” und wirtschaftlich, so sei man in der ÖVP überzeugt, würde sie das Sagen haben.
Nicht, dass ich den blau-türkisen “Volkskanzler” damit für wahrscheinlich hielte – aber für ganz unwahrscheinlich halte ich ihn nicht mehr.
Hans Rauscher hat im DerStandard ausgeführt, wie wichtig es ist, dass eine konservative Partei entscheidende Werte mit der Linken teilt und ich möchte das unterstreichen. Ich sehe eine Katstrophe darin, dass der ÖVP ihr christlich-soziales Fundament abhanden kommt. Am eindrücklichsten illustriert das die Haltung schwarzer Granden zu Sebastian Kurz: sie wollten sich von ihm nicht einmal distanzieren, als offenbar wurde, dass er alles unternommen hat, um zu verhindern, dass Reinhold Mitterlehner mit Christian Kern 1,5 Milliarden für die schulische Förderung von Kindern beschließt, obwohl das viel übler als selbst die Korruption ist, deren er verdächtigt wird.
Wenn ich mich frage, wie die jedenfalls gegebene Gefahr eines blau-türkisen Volkskanzlers im verbleibenden Jahr ausgeschlossen werden kann, fällt mir leider nicht viel ein: Die FPÖ wird ihr Umfragehoch in einen Wahlsieg verwandeln. Nehammer hat nur mehr wenige Möglichkeiten zu punkten: Schwarz-Grün wird irgendwann doch das Transparenzgesetz beschießen, das nur umstritten ist, weil es Bürgermeistern die Möglichkeit korrupter Baubewilligungen erschwert. Er hat ferner die vom Verfassungsgerichtshof eröffnete Möglichkeit, ein ORF- Gesetz zu beschließen, das den Einfluss der Parteien so einschränkt, dass Kickl nicht mehr behaupten kann, die Berichterstattung über die FPÖ sei parteiisch. Leider meint ein anderer diesbezüglicher Insider, die ÖVP wolle einen VP-nahen ORF und würde alles tun, ihn dazu zu machen, ehe ein neues ORF-Gesetz das verhindert. Schließlich könnte Nehammer mit dem größten Applaus das Gesetz beschließen, das eine parteiunabhängige Spitze der Staatsanwaltschaft sicherstellt. Aber daran zweifelt mein zweiter Gesprächspartner noch mehr: Derzeit wolle die ÖVP die WKSTA diffamieren und danach einen alleinigen Bundesanwalt installieren, der ihr nahesteht.
Theoretisch könnten die Grünen die ÖVP bei allen diesen Gesetzen zu Eile und Sauberkeit drängen, indem sie erklären, die Koalition andernfalls zu sprengen – nur dass sie die folgenden Neuwahlen in der Praxis kaum minder als diese zu fürchten haben. Ich meine freilich, dass das jedenfalls so ist, so dass sie auch energischer drängen und dieses Risiko in Kauf nehmen könnten.
Für absolut verfehlt halte ich die Taktik der SPÖ und Andras Bablers, Nehammer genauso heftig zu kritisieren wie Kickl es tut. Erstens machen sie Kickl damit glaubwürdig und treiben ihm Wähler zu; zweitens muss die SPÖ mit Nehammer koalieren, wenn sie Schwarz-Blau abwenden will; drittens ist ihre aktuell zentrale Kritik – dass Schwarz-Grün die Teuerung so viel schlechter als andere Regierungen bekämpfe – höchst problematisch: Es waren vorangegangene Regierungen, die Österreich eine so extreme Abhängigkeit von russischem Gas bescherten, dass sie doppelt so hoch wie die Deutschlands ausfiel. Es ist absurd, Teuerungsraten zu vergleichen, ohne zu berücksichtigen, wie die Energieversorgung eines Landes beschaffen ist.
In Wirklichkeit sollte man in der SPÖ beten, dass ihr Nehammer als ÖVP-Obmann erhalten bleibt. Denn seine Ablehnung dessen, was ein Volkskanzler Kickl für Österreich bedeutete, ist ehrlich.