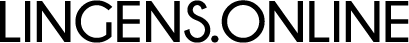Die historische Belastung des realen Kommunismus mit Blut und Elend wiegt erstaunlich wenig. Traditionelle linke Politik angeblicher Kommunisten beeindruckt zu Recht.
Es gibt eine kurze Antwort auf die im Titel gestellte Frage: Die Schere zwischen hyperreich und relativ arm war lange nicht so groß, und Ahnungslose meinen, dass das im Kommunismus anders war. Gemäß einer Gallup Umfrage können sich daher 24 Prozent der Österreicher vorstellen die Kommunistische Partei (KPÖ) zu wählen. Am ehesten mit 29 Prozent Sympathisanten der SPÖ, aber mit 27 Prozent auch Grün-Affine. Am meisten verblüfft, dass sich selbst 25 Prozent Neos-Affiner vorstellen können, kommunistisch zu wählen, während es unter ÖVP-Affinen nur 13 Prozent sind. Weniger verblüffend: Dass die Bereitschaft bei unter 30-Jährigen mit 33 Prozent am höchsten ist – dies entspricht der Qualität unseres Geschichtsunterrichts – und dass sie bei Freiheitlichen mit 16 Prozent ähnlich niedrig wie bei VP-Affinen ist; Neo-Faschismus liegt ihnen vermutlich näher als Neo-Kommunismus.
Am Rande erklären diese Zahlen, warum eine “linke” SPÖ unter Andreas Babler laut Umfragen mehr Stimmen als eine “rechte” unter Hans Peter Doskozil erhielte: Sie nähme Grünen und Neos am ehesten Stimmen weg. Dadurch wird aber die von Babler erhoffte rot-grün-pinke Koalition um nichts wahrscheinlicher.
Obwohl das der realpolitisch bedeutsamste Schluss ist, den man aus der überraschenden Kommunismus-Akzeptanz der Österreicher ziehen muss, beeindruckt mich einmal mehr, wie wenig die historische Belastung einer Weltanschauung wiegt. Immerhin sind in der kommunistischen Sowjetunion allein aufgrund der “Zwangskollektivierung” (Enteignung der Bauern zugunsten staatlicher Agrar-Kombinate) schätzungsweise sieben Millionen Menschen verhungert und wurden bis zu Stalins Tod im Jahr 1953 mindestens 18 Millionen Menschen als angebliche “Konterrevolutionäre” verhaftet, von denen 2,5 Millionen im “Archipel Gulag” starben und weiter 700.000 hingerichtet wurden. Gleichzeitig entstand die ungerechteste Gesellschaft, die man sich vorstellen kann: Parteifunktionäre besaßen zwar nichts, verfügten aber über absolut alles – prachtvollen Datschen bis zur eigenen Autobahn. Gleichzeitig war die Bevölkerung nicht nur relativ, sondern absolut arm. Kommunismus war und ist in jedem Land, in dem er herrschte – von Kuba über Kambodscha bis China -, mit Elend und Folter verbunden: Auch geflohene Kubaner haben Folternarben; dass es der Masse der Chinesen trotz Folter ökonomisch immer besser geht, liegt daran, dass ihre Wirtschaft immer weniger mit Kommunismus zu tun hat. Auch die Forderung der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) oder des Salzburger KPÖ-Shootingstars Kay-Michael Dankl haben nichts mitKommunismus zu tun.
Die historische Belastung des realen Kommunismus mit
Blut und Elend wiegt erstaunlich wenig. Traditionelle
linke Politik angeblicher Kommunisten beeindruckt zu recht
Beide fordern nur glaubwürdiger als andere normle linke Politik ein, die natürlich sinnvolle staatliche Eingriffe umfasst. Dass sie sich Kommunisten nennen, ist ihr privates Steckenpferd, auch wenn es zweifellos am meisten zur öffentlichen Akzeptanz der KPÖ beträgt
Der historische Kommunismus ist etwas anderes und lässt sich nicht vom Marxismus trennen, zu dem sich der neue SPÖ Chef Andreas Babler aus Privatvergnügen – sicher nicht aus Kenntnis – bekennt. Bablers Unterstützer wandten ein, dass selbst Karl Popper, Auto von “Die offene Gesellschaft und ihre Feinde”, einst Kommunist war – aber im Jahr 1922 mit 20 Jahren, nicht wie Babler 2023 mit 50 Jahren.
1922 wusste man noch nicht vom Elend und den Verbrechen, die der Kommunismus hervorgebracht hatte. Der Journalist Arthur Köstler hatte Folter und Schauprozesse in Russland noch nicht beschrieben. Marxismus war 1922, als Karl Popper sich ihm hingab noch nicht blutbefleckt, sondern eine faszinierende ökonomische Theorie, die die überragende Bedeutung von Eigentum und Profit erstmals in den Mittelpunkt stellte. Für Popper Generation galt das Bonmot: Wer mit 20 kein Marxist war, war nicht anständig – wer es mit 50 noch immer ist, ist nicht intelligent.
Aus seiner Kenntnis des Marxismus heraus hat Popper dessen kardinale Schwächen aufgezeigt: Marx, der viele große Risiken des Kapitalismus richtig sah, vermeinte fälschlich, aus ihnen ein “ehernes Gesetz” ableiten zu können, wonach sie zwingend zum Zusammenbruch des Kapitalismus führen müssen, der wiederum mit dem Sieg des Sozialismus enden muss. Wenn dem so ist, bräuchte es keine Gewerkschaften, um den Kapitalismus zu zähmen. Marx lehnte Gewerkschaften ab und warf ihnen vor, durch “Scheinerfolge” den Zusammenbruch des Kapitalismus und den Sieg des Sozialismus hinauszuzögern. Folgerichtig gab es in kommunistischen Staaten keine Gewerkschaften, die den Kapitalismus in allen anderen Staaten in gewisse Schranken wiesen (die Gewerkschaft Solidarność entstand in Polen 1980gegen den Willen des damaligen KP-Regimes). Gleichzeitig war die Überzeugung, dass der Sozialismus siegen müsse, eine willkommene Rechtfertigung, dafür, diesem Zweifel durch Folter nachzuhelfen.
Die zweite Schwäche der Marx´schen Theorie bestand darin, dass sie zwar lehrte, der siegreiche Sozialismus bestehe in der “Vergesellschaftung der Produktionsmittel”, nicht aber, worin “Vergesellschaftung” bestehe, denn das bescherte der Kommunistischen Partei die maximale Macht. Allerdings lehrte Otto Bauer diese Auslegung. Durch “Verstaatlichung”, so spottete er, hätten statt versierter Kaufleute ahnungslose Beamte das Sagen in Unternehmen. Es ist sicher nicht Kenntnis”, die SPÖ und Babler “Verstaatlichung” dennoch für “sozialistisch” halten lässt.